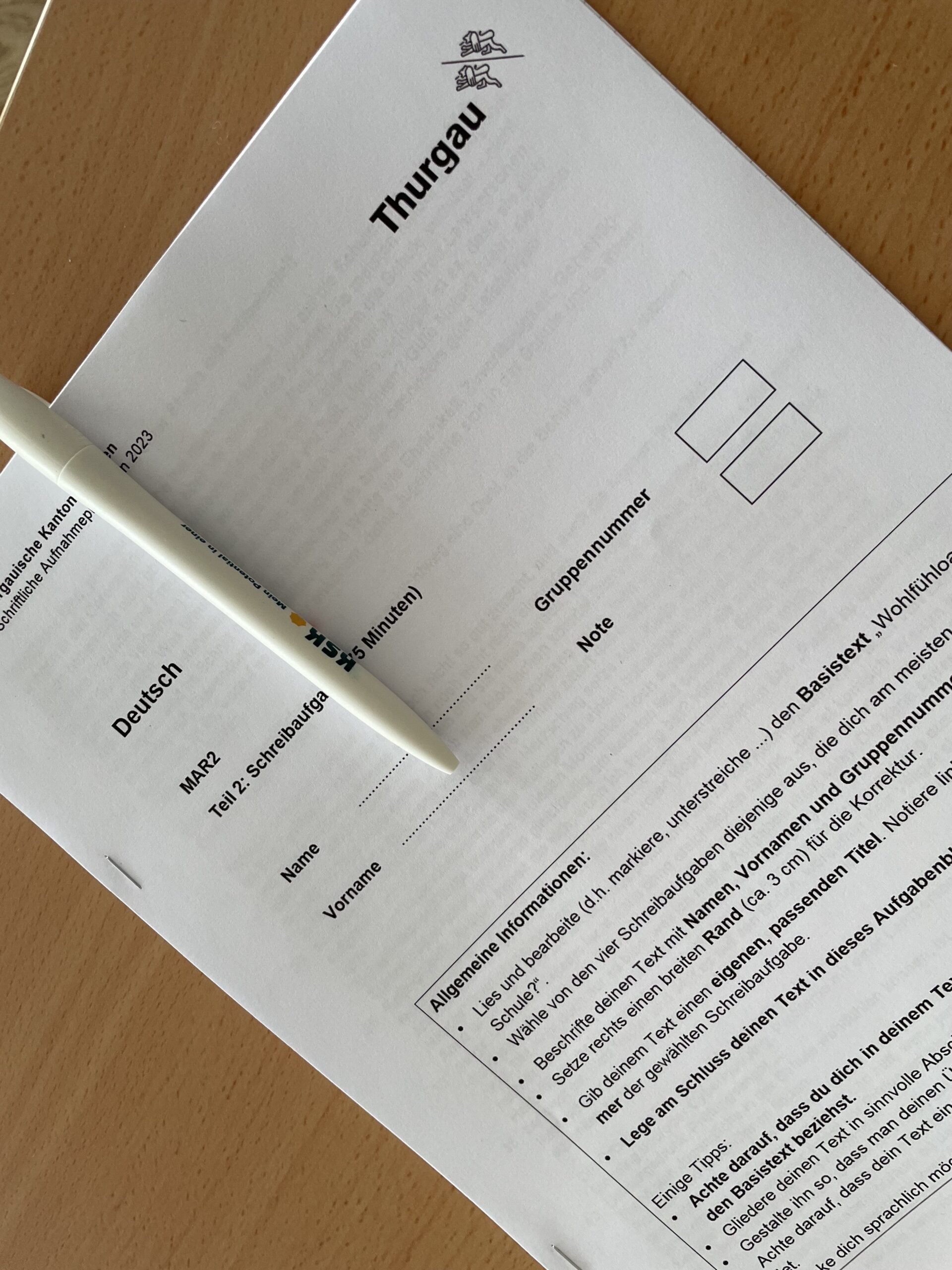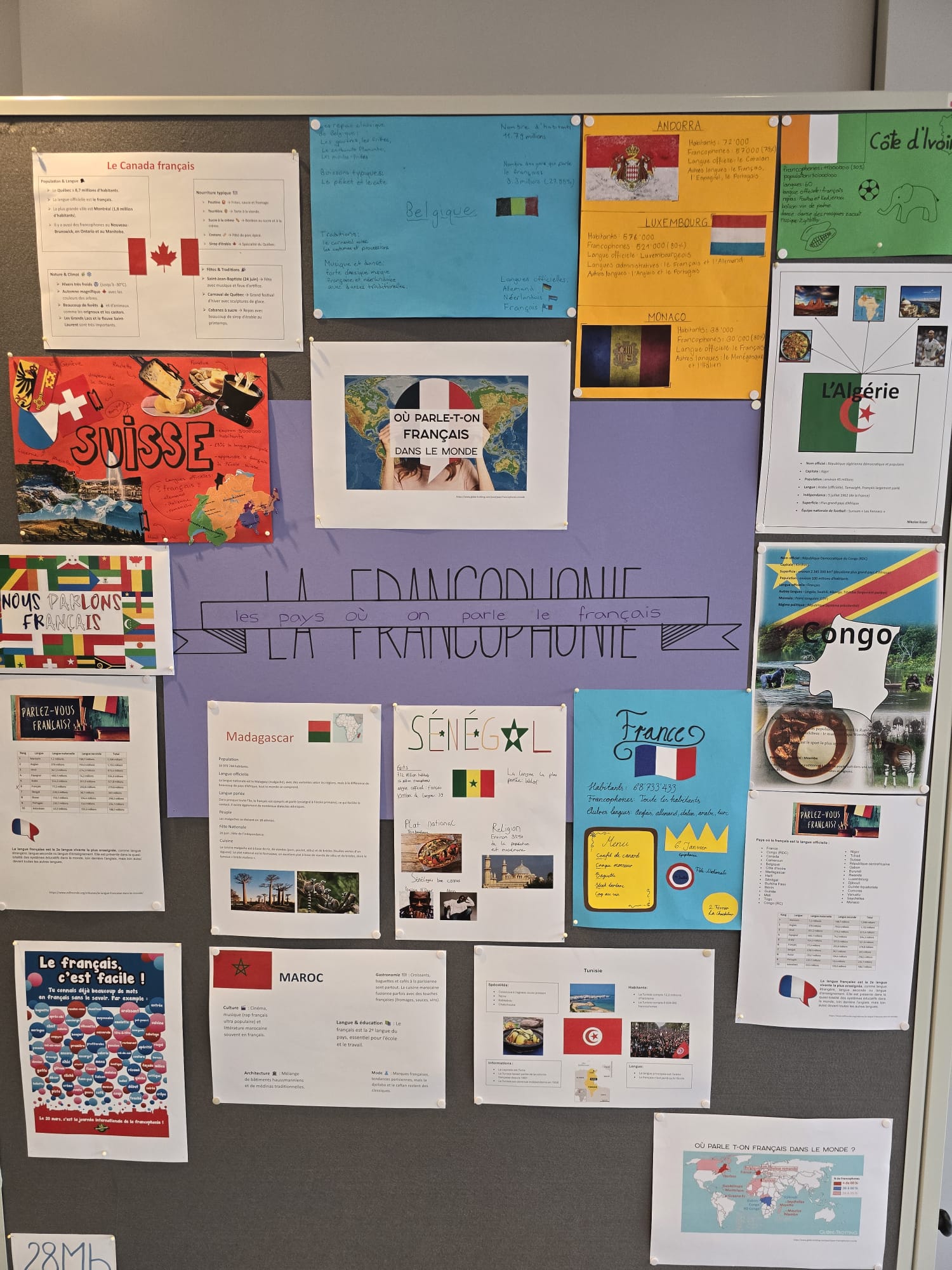«Wo die Sprache verroht, ist der Frieden bedroht.» Mit diesem Zitat des Pädagogen Wolfgang Lörzer (*1950) eröffnet Rektor Dr. phil. Marcello Indino den KSK-Dialog zum Thema «Interkulturelle Kompetenzen». Dr. phil. hist. Adrian Juric, Lehrer an der KSK und Dozent für Englisch und Französisch an der PHTG, forscht im Rahmen eines Projektes zur Mehrsprachigkeitsdidaktik (unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds) und hält das Referat zum Thema.
Carina Lukosch
Wenn verrohte Sprache den Frieden bedrohe, dann könne Sprache im Umkehrschluss Frieden bringen. «Umso mehr Sprachen wir beherrschen, umso mehr Frieden können wir bringen», formuliert der Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen, Marcello Indino, einleitend und hebt hervor, dass das Beherrschen einer Sprache viel mehr als die Kenntnis von Worten sei. Echtes Verstehen bedürfe nämlich auch der Kenntnis kultureller Gepflogenheiten. Und genau hier setzt Juric, selbst muttersprachlich kroatisch, an.

«Kultur ist nie in Stein gemeisselt»
Etymologisch wird der Begriff Kultur von lateinisch «cultura» hergeleitet und umfasst das vom Menschen Geschaffene. Die Weltgesellschaft ist von Vielfalt gekennzeichnet und ebenso vielfältig sind auch die Definitionen eines Kulturbegriffes. Kultur, so der Fremdsprachenlehrer, «ist niemals in Stein gemeisselt, sondern von Austausch geprägt». Der Didaktiker zieht zur Veranschaulichung des Kulturbegriffes das Eisberg-Modell von Edward T. Hall heran. Die Werte, die im Begriff Kultur vereint sind, seien in sichtbare und unsichtbare unterteilt. Als sichtbare Werte werde alles subsummiert, was mit den Sinnen wahrgenommen werden könne: Sprache, Dialekte, Art und Weise von Kommunikation, Kleidung und vieles mehr. Die unsichtbaren Werte hingegen seien jene, die in Fachkreisen als «deep culture» bezeichnet würden. Zu ihnen zählen Einstellungen, Normen, Rollenverhältnisse Überzeugungen und anderes mehr.
Der Fremdsprachenlehrer sieht die interkulturelle Kompetenz als Schlüssel für eine offene und offenherzige Weltgesellschaft und für einen vorurteilsfreien Umgang. In unserer heterogenen Welt reiche es nicht aus, nur die sichtbaren Kulturwerte zu (er)kennen und zu beherrschen, besonders die unsichtbaren hätten eine grosse Bedeutung. Interkulturelle Kompetenzen eröffneten, so Adrian Juric, «enorme Chancen, lediglich der Umgang will gelernt sein». Es sei eben nicht das im Präfix «multi» steckende Nebeneinander, sondern vielmehr das einbeziehende «inter», das das Miteinander und das so wichtige sich gegenseitige Beeinflussen ausdrücke.
SNF-Forschungsprojekt zur Mehrsprachigkeitsdidaktik
Und genau hier setzt sein Forschungsprojekt an: Im ersten Schritt wurde im Juni 2024 von 42 Studierenden (Primarschule) die individuelle Bedeutung des Begriffes «interkulturelle Kompetenz» gesammelt. Hier kamen besonders kognitive Kompetenzen zum Ausdruck (z.B. Sprache, Gepflogenheiten). Nach einem Praktikum der Befragten (in England, Irland oder der Romandie) fand die zweite Erhebung der Daten statt. «Das Ergebnis ist spannend. Die Fähigkeit, sich empathisch und flexibel in neuen Kontexten zu bewegen, hat an Gewicht gewonnen. Aufenthalte in anderen Kulturgebieten prägen also mehr als die rein kognitive Auseinandersetzung und zeigen, wie wichtig eine ganzheitliche interkulturelle Kompetenz ist», stellt Juric fest und weist mit einem Lächeln auf die Sprachaufenthalte der KSK hin.
Interkulturelle Kompetenz sei vielfältig und aus allen Teilkompetenzen benötige man verschiedene Aspekte für ein erfolgreiches Handeln in interkulturellen Situationen. So wundert es nicht, dass auch die schulischen Curricula hier einen Fokus setzen. An der Kanti Kreuzlingen sieht Juric die interkulturellen Kompetenzen in verschiedenen Bereichen, etwa in Projekten und Sondertagen wie dem «MyDay», dem «Kultouren»-Tag, in UNESCO-Projekten sowie im Fachunterricht wie den Fremdsprachen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern (Exkursion nach Dachau, Erinnerungskultur, Kulturunterricht) verankert.
«Interkulturelle Kompetenz wächst mit jeder Begegnung»
Die Welt verändert sich, Kulturen begegnen sich. Wenn wir unsere Türen und Herzen öffnen und in eine neue bunte Welt eintauchen, lernen wir nicht nur unsere eigene Kultur besser, sondern auch andere Kulturen neu kennen und können so einen Beitrag zu einer friedlichen Weltgesellschaft leisten. «Frieden war der Einstieg und damit wird der Vortrag auch beendet», greift Marcello Indino Jurics schliessende These auf und eröffnet die Diskussion mit der Frage, ob man aus der Untersuchung ableiten könne, ab wann nach einem Aufenthalt in einem anderen Kulturkreis ein Effekt eintrete.
Es ging an diesem Abend des 13. März um die Frage nach einem kompetenten Leben im Spannungsfeld zwischen Nationen und Kulturen, um den Unterschied zwischen Anpassung und Akzeptanz, um die Ambiguitätskompetenz, um die Frage, wie Eltern interkulturelle Kompetenz bei ihren Kindern fördern können, wo es in der Politik vielleicht Nachholbedarf gibt, um Haltungen und wie schwer es sei, diese zu beeinflussen oder gar zu verändern. Wie kann ich etwas aushalten, das überhaupt nicht meinen Vorstellungen entspricht? «Man muss nicht mit allem einverstanden sein, man muss auch nicht alles kommentieren», meint Juric und empfiehlt das innere auf Zehn Zählen, bis man merke, man sei bereits bei Hundert.
Vielen Dank, Adrian Juric, für diesen erhellenden KSK-Dialog!
Nächster Termin: Dienstag, 13. Mai 2025 um 18.30 Uhr: Umweltbildung im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (Prof. Dr. Christina Colberg, PHTG / Beirätin KSK)